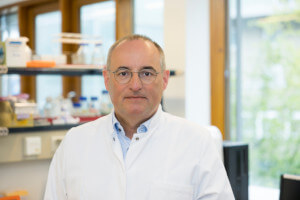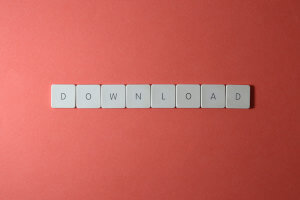Neue AG zu Krebserkrankungen des lymphatischen Systems: Forschung in Klinik und Labor
Non-Hodgkin-Lymphome (NHL) sind die vierthäufigste Krebserkrankung bei Kindern und Jugendlichen. Es handelt sich um eine Gruppe an bösartigen Erkrankungen des lymphatischen Systems, das neben Lymphknoten, Knochenmark, lymphatischen Geweben der Mandeln, Milz und des Darms alle Organe befallen kann. Mit seiner seit Januar 2025 am Forschungsinstitut Kinderkrebs-Zentrum Hamburg angesiedelten Arbeitsgruppe „Non-Hodgkin-Lymphome“ erforscht Prof. Wilhelm Wößmann diese Krebserkrankung auf verschiedenen Ebenen.
Seit 2018 ist Prof. Wößmann stellvertretender Direktor der Klinik für Hämatologie und Onkologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und forscht seit über 20 Jahren zu Non-Hodgkin-Lymphomen. So betreibt er gemeinsam mit Prof. Dr. Dr. Birgit Burkhardt vom Universitätsklinikum Münster das NHL-Register. Eine strukturierte Datenbank sammelt, dokumentiert und analysiert Informationen zu Diagnose, Behandlung und Verlauf von NHL bei Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, durch klinische und Laborforschung an Restmaterial die Versorgung der Patientinnen und Patienten zu verbessern. Zudem führt Wößmann eine europaweite Studie zum großzelligen anaplastischen Lymphom (ALCL) durch, der dritthäufigsten Form von NHL in dieser Altersgruppe. Die Studie testet erstmals eine ambulante milde Chemotherapie. Er plant weitere klinische Studien mit neuen gezielten Medikamenten.
Das Hamburger Labor fungiert zusammen mit dem Universitätsklinikum Münster auch als Referenzlabor für alle NHL-Diagnosen. Es überprüft die Erstdiagnosen, analysiert Befunde aus Hirnwasser und Knochenmark und bestimmt die minimale Resterkrankung (MRD), die zur Therapiesteuerung bei einigen Untergruppen und im Rückfall genutzt wird.
Präzise Methoden für die Routine-Diagnostik
Bereits vor einigen Jahren gelang es dem Kinderonkologen mit seinem Team, eine zuverlässige Methode für den Nachweis der minimalen Resterkrankung bei ALCL zu etablieren. Mithilfe der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) werden dabei bestimmte Genabschriften, sogenannte Transkripte, nachgewiesen. Die Transkripte bestehen aus RNA, die im Labor weniger stabil ist als DNA. Deshalb erforschen die Wissenschaftler derzeit, ob sich die minimale Resterkrankung auch auf DNA-Ebene bestimmen lässt – etwa durch die Analyse zellfreier DNA.
Therapieerfolge entschlüsseln
Warum Chemotherapien bei manchen Kindern mit ALCL wirken, bei anderen jedoch nicht, untersucht die Arbeitsgruppe zusammen mit Forschern aus Kiel und Essen. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Lymphome nicht durch die Therapie resistent werden, sondern von Anfang an Unterschiede bestehen. „Diese Unterschiede verstehen wir noch nicht“, sagt Wößmann. „Die Tumorzellen sehen gleich aus und zeigen die gleiche chromosomale Veränderung. Wir prüfen derzeit, ob die Kinder unterschiedlich starke Immunsysteme gegen das ALCL haben oder die Eigenschaften der Tumorzellen unterschiedlich sind.“ Die Forscher bestimmen systematisch Antikörper im Blut von Patienten, suchen nach zellulären Immunantworten und vergleichen, ob es genetische Unterschiede gibt, die das Abwehrsystem schwächen. Gleichzeitig schaffen diese Untersuchungen die Basis für die Entwicklung einer Immuntherapie, um das Rückfallrisiko zu senken.
Kooperation und Austausch
Mit dem Beitritt zum Forschungsinstitut freut sich Wößmann darauf, den Austausch mit den anderen Arbeitsgruppen am Institut zu intensivieren – etwa zu Nachweisverfahren für Antikörper oder zur Forschung an zellfreier DNA. Besonders spannend sei etwa die Frage, ob sich die Tumorheterogenität durch zellfreie DNA besser nachweisen lässt als durch Tumorgewebeproben.